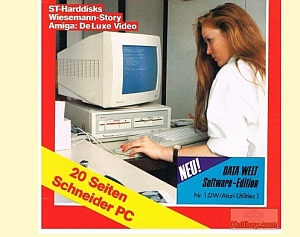Woran immer es liegen mag: Ich hab’s nicht so mit Hobbyisten. Und ich hatte es auch noch nie mit Leuten, die mit irgendeiner mehr oder weniger sinnvollen Sache ihre Freizeit füllen – und das am Rande der Manie. Sammler finde ich irgendwie gaga, Leute, die ohne Not mit etwas Motorisierten für Spaß in der Gegend rumkariolen, halte ich für bescheuert und gefährlich. Nun bestand aber die Welt der kleinen Computer in den frühen und mittleren Achtzigerjahren fast nur aus solchen Hobbyisten. Gefragt, was denn ihr Hobby sei, antworteten Vertreter dieser Spezies “Computer”. Entsprechend meiners Weges hin zu den kleinen Elektronenhirnen fand ich das absurd. So eine Kiste sollte nützlich sein. Punkt. Damit sollte man schreiben, rechnen und speichern können. Und zwar schnell und einfach. Aber, mal ehrlich, was war denn einfach in der Ära von C64 und Konsorten? Deshalb war es auch nach meiner Anschauung eine winzige Minderheit, die – sagen wir mal – vor 1987 einen Computer privat wirklich zum Arbeiten benutzten. Vorwiegend handelte es sich dabei um Besitzer eines Apple Macintosh – denn mit dem ging Arbeiten einfach. Die große Masse hatte sich eine Kiste angeschafft, ohne wirklich zu wissen, wozu.
Nun wandte sich die Firma Data Becker mit allem, was sie anbot, an solche Hobbyisten. Kein Wunder, war doch Dr. Achim Becker selbst ein solcher Hobbyist. Wie alle seiner Art – übrigens gehörte der unvergessene Chris Howland ebenfalls zu diesen Verrückten – war er in die Technik und ihren Fortschritt vernarrt. Diese Haltung bildete das eigentliche Konzept unserer Data Welt: Gib dem Computer-Freak, was er braucht. In den Zeiten, in denen es kaum brauchbare Software zu kaufen gab, aber jeder Kleincomputer mit Basisc programmiert werden konnte, standen Listings hoch im Kurs. Alle waren scharf auf Listings, also (vorwiegend Basic-)Programme zum abtippen. Ja, zum ABTIPPEN! Wir druckten also seitenlang und Zeile um Zeile Programmcode, den unsere Leser dann daheim wieder Zeile für Zeile, Befehl für Befehl in die Tastatur ihres Homecomputers hackten. Für den Verkaufserfolg waren diese Listungs enorm wichtig. Sie mussten vor allem funktionieren. Das heißt: Auch wenn unsere Artikel nicht immer besonders sorgfältig lektoriert waren und auch gern mal ein Fakt ncht stimmte, wurde jedes Listing zigfach geprüft und getestet.
Weil wir aber immer vielviel Listings bringen wollten/sollten, hatten wir ein Nachschubproblem. Und luden unsere Leser ein, uns ihre Programme zu verkaufen. Diese Lieferanten bildeten ein lustiges Völkchen. Da war der Straßenbahnfahrer, der – ohne jede Datenbank – eine Superduper-Video-Verwaltung in Basisc für den C64 geschrieben hatte. Ein Pensionär aus Oberbayern lieferte massenhaft so kleine Progrämmchen für den Alltag – ein sehr rudimentäres Haushaltsbuch, einen Fahrtkostenkalkulator etc. Und nicht wenige kamen uns dann auch in der Redaktion besuchen: langhaarige, völlig bekiffte Späthippies, die ihr Programm zwar nicht erklären konnten, das aber trotzdem lief. Spinner und Weltverbesserer, Arbeitslose und IQ-Allergiker, Professoren und Pastoren – nur Frauen war nie darunter. Hatte einer was richtig Tolles eingereicht und wies der Begleittext auf eine halbwegs brauchbare Schriftsprache hin, wurde der Kontakt sofort an den Buchbereich und die Softwareabteilung weitergegeben. So beschafften wir dem Hause Data Becker über die Jahre eine ganze Menge begabter Autoren.
Die zweite Rekrutierungsschiene ergab sich aus den zahlreichen Ausbildungsstellen des Hauses – angeboten wurden vor allem Lehrstellen für DV-Kaufleute, was um 1985 herum ein angehender Modeberuf war, den vor allem Jungs einschlugen, die eben nicht nur aus Jux und Dollerei programmieren, sondern diese Tätigkeit zum Beruf machen wollten. Talente wie der inzwischen hochbekannte Jörg Schieb waren darunter – der hatte den Textomat programmiert und unter einigem Druck die ersten Artikel für die Data Welt geschrieben. Aus diesem ganzen Jungvolk, das im Schnitt fast zehn Jahre jünger war als ich, ragte aber eine Figur heraus, die es sogar zu Weltruhm in der IT-Branche bringen sollte: Marco Börries aus Lüneburg – ein sehr junger Kerl, der mit seiner Einstellung zum Computer voll auf meiner Linie lag. Der hatte mit knapp sechzehn Jahren eigenhändig eine tolle Textverarbeitung für den Amstrad CPC verfasst, die er Starwriter nannte. Dieser CPC, der in Deutschland vom Unterhaltungselektronikunternehmen Schneider aus dem Allgäu angeboten wurden, lief mit dem Betriebssystem CP/M und erfreute sich schnell einiger Beliebtheit bei Leuten, die mit so einem Rechner arbeiten wollten, aber keine 10.000 Mark für einen Macintosh oder IBM PC ausgeben wollten. Dieser Starwriter wurde rasch ein Erfolg, zumal es auch eine Version für den C64 gab.
Wir testeten das Programm und befanden es – obwohl es mit dem Data-Becker-Produkt Textomat konkurrierte – für gut. Das gefiel dem jungen Marco so sehr, dass er den Kontakt mit der Redaktion suchte. Sein erster Auftritt im Hause war sehenswert. Inzwischen hatte er, kaum siebzehnjährig, die Firma Stardivision gegründet und etliche Leute eingestellt; vor allem alte Kumpels und Schulfreunde. Weil der Verkauf richtig brummte und ordentlich Geld brachte, ließ die Clique es ordentlich knallen. Jedenfalls fuhr am Tage des Besuchs eine schwarze Limousine (vermutlich ein 7er-BMW) in der Langversion vor. Da der junge Herr Börries noch keinen Führerschein hatte, wurden er und seine Jungs von einem Chauffeur kutschiert. Einen Hauch arrogant gab er sich schon… Aber wir freundeten uns an dem Tag einigermaßen miteinander an. Und so wurde ich einige Zeit später allererster Beta-Tester der MS-DOS-Version. Der weitere Weg von Marco Börries und seiner Bürosuite Staroffice ist bekannt: Firma und Produkt wurden von Sun gekauft und später zu OpenOffice, eine heute als Open-Source-Produkt weit verbreitete Anwendung für verschiedene Betriebssysteme. Marco Börries ging in die USA und wurde Topmanager im damals alles überstrahlenden Unternehmen des Andreas von Bechtoldsheim (den kennenzulernen ich das Vergnügen leider nie hatte).
Das wirklich entschneidende Ereignis für meine Sicht auf den Computer war das Erscheinen der IBM-Klone. Da mir das Texten am Computer immer so wichtig war, hatte ich einen der allerersten Mac-Würfel in Deutschland gekauft und war auch ganz glücklich damit. Da ich aber inzwischen auch an der Technik hinter der Funktion interessiert war, hatte ich auch sehr früh angefangen, mich mit dem IBM PC zu befassen – und beinahe hätte ich ein Komplettsystem für über 20.000 Mark gekauft. Mehr intuitiv war mir aber etwa ab 1987 klar, dass so ein Mac mit seiner grafischen Benutzeroberfläche ganz nett sei, das Potenzial des Betriebssystems MS-DOS aber trotzdem größer. Allein schon deshalb, weil es nicht proprietär war, also auch andere Hersteller es nutzen konnten. Traurig war ich aber über das Schicksal von CP/M, weil ich an der durchaus hippiesken Firma Digital Research einen Narren gefressen hatte. Schon damals ging die Legende, dass sich IBM für dieses merkwürdige DOS des jungen Bill Gates entschieden hatte, weil Gary Kildall, der Macher von Digital Research, auf Anfragen nach ihrem CP/M wegen eines Segelausflugs nicht schnell genug reagiert hatte. Dafür waren die aber auch schon auf einem anderen Trip und bastelten an einer grafischen Benutzeroberfläche nach Mac-Art. Die nannten sie GEM.
Auf einer CeBIT, vermutlich der von 1985, hatte ich Reinhard Gründer kennengelernt, den Deutschlandchef von Digital Research. Ein begnadeter Kommunikator mit einem Hang zum Aufschneiden und dem erfolglosen Versuch, sich als echter Münchener zu geben. Wir waren uns gleich sympathisch. So kam ich dazu, als allererster Fachjournalist nach dem Signieren diverser Verschwiegenheitserklärungen dieses verrückte GEM in der Version für MS-DOS zu sehen. Benutzen durfte ich das dann erst ein paar Wochen später. So kam es in der Ausgabe 2/86 zu einem Vergleichstest zwischen Windows, GEM, Taxi (was immer das gewesen sein mag) und GSX, einem exotischen GUI für diese japanischen Homecomputer. Und das unter der Fragestellung “Machen Grafik, Windows und Mäuse den Computer komfortabler?” Das alles quasi parallel zum schnelle Aufkommen der Homecomputer einer der nächsten Generation. Dass GEM dann die Oberfläche des legendären Atari ST wurde, ist ein noch wesentlich größerer Zufall als die IBM-Entscheidung für MS-DOS. Denn eigentlich hatte Shiraz Shivji, der ST-Erfinder, ein eigenes GU basteln lassen, das aber partout nicht funktionieren wollte. Die Anfrage bei Digital Research, ob man GEM in weniger als zwei Monaten ST-kompatibel machen könne, lautete Ja. Und mit Hilfe von Heerscharen freier Programmierer klappte das dann auch.
Während ich gedanklich schon voll auf MS-DOS und, ja, auch Windows abfuhr, entbrannte dann der große Krieg zwischen den ST-Jüngern und den hippen und coolen Fans des Commodore Amiga. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und damit endet diese kleine Serie, die zuerst in der Rainer’schen Post erschien, zunächst.