Es gibt Menschen, die IT-Geschichte schreiben, ohne dass es jemand merkt. Hermann Achilles war so einer. Während wir alle in den 90ern unsere Amiga-Disketten kopierten und über Doom diskutierten, baute er im Hintergrund die Strukturen auf, die aus einer chaotischen Szene eine respektierte Industrie machen sollten. Im Gespräch mit dem ehemaligen VUD-Geschäftsführer wird klar: Ohne Männer wie ihn gäbe es heute keine Gamescom.
Wenn ich an die wilden 90er Jahre denke, sehe ich vor allem eines: stapelweise kopierte Disketten, endlose Diskussionen über indizierte Spiele und eine Branche, die niemand so richtig ernst nahm. Was ich damals nicht wusste: Im Hintergrund kämpften Menschen wie Hermann Achilles dafür, dass aus dieser chaotischen Szene eine respektierte Industrie wurde.
Als Raubkopierer das größte Problem waren
„Das erfolgreichste Programm, was den Amiga betraf, war ein Programm namens X-Copy“, erzählt Hermann mit einem wissenden Lächeln. „Damit konnte man natürlich vervielfältigen, was man hatte in unbegrenzter Zahl.“
Wer die Amiga-Zeit miterlebt hat, kennt das Dilemma: Einerseits war X-Copy ein technisches Meisterwerk, das selbst komplexeste Kopierschutzmechanismen knackte. Andererseits war es der Alptraum jedes Publishers. Hermann sah das Problem von der anderen Seite – als jemand, der eine ganze Branche verteidigen musste.
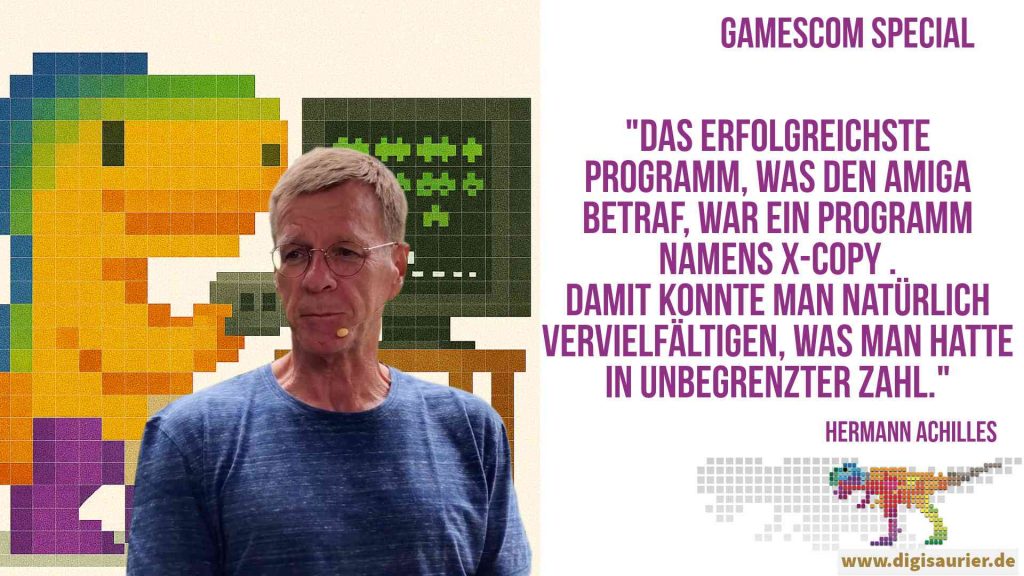
Und – das weiß ich aus allerhand Hintergrund-Gesprächen damals mit den Produzenten der Hardware (und damit meine ich nicht nur Commodore) dass man dort das Problem der Raubkopien zwar sah – aber gleichzeitig nicht nur traurig darüber war. „Je mehr Programme sich verteilen unter den Nutzern, umso besser für unsere Verkäufe.“ Dieses wörtliche Zitat eines der Hardwarebosse der Zeit damals, machte deutlich was viele dachten. Offiziell verurteilte man die Raubkopien. Inoffiziell sah man durchaus die Vorteile für das eigene Geschäft. Einige war natürlich klar, dass Software die nicht bezahlt wurde, auch Probleme machte. Denn man brauchte die Programmierer und die mussten ja von etwas leben. Schwierige Zeiten. Komplexe Situation. „Aber die verkaufen ja eh auch genug…“ beruhigte sich die Hardware-Branche dann selbst.
Für Hermann war klar, dass der Verband ganz eigene Wege gehen musste und nicht nur irgendwo mit unterschlüpfen konnte. Film oder Musik hätten sich ja auf den ersten Blick angeboten. Aber eben nur auf den ersten Blick.

„Interessen, die vorher schon bestanden von zum Beispiel der Filmindustrie waren nicht einfach zu übertragen auf die Computerspiele“, erklärt er die damalige Herausforderung. Ein Film läuft linear ab, ein Spiel lebt von der Interaktion. Völlig neue rechtliche und gesellschaftliche Fragen taten sich auf.
Der VUD – Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland – war – gemeinsam mit einigen Mitstreitern aus der Branche – Hermanns Antwort darauf. Gegründet mit Branchengrößen wie Jürgen Goeldner von Rushware oder Wolfram von Eichborn, der später zu Electronic Arts wechselte. Namen, die heute vor allem nur noch Insider kennen, die aber damals die Speerspitze einer entstehenden Industrie bildeten.
Doom und die Panik der Jugendämter
Besonders lebendig wird Hermann, wenn er über die Gewalt-Diskussion spricht. „Es gibt da bestimmte Paradebeispiele. Ich denke mal an so Sachen wie Doom, die von Anfang an plötzlich in Deutschland verboten waren, aber keiner konnte so richtig sagen warum ist es eigentlich verboten?“
Ich erinnere mich gut an diese Zeiten der Unklarheit. Da wurde ein Spiel indiziert, in dem pixelige Figuren auf pixelige Monster schossen – während zeitgleich im Fernsehen brutalste Actionfilme liefen. Der Unterschied? Bei Doom drückte der Spieler selbst den Abzug.
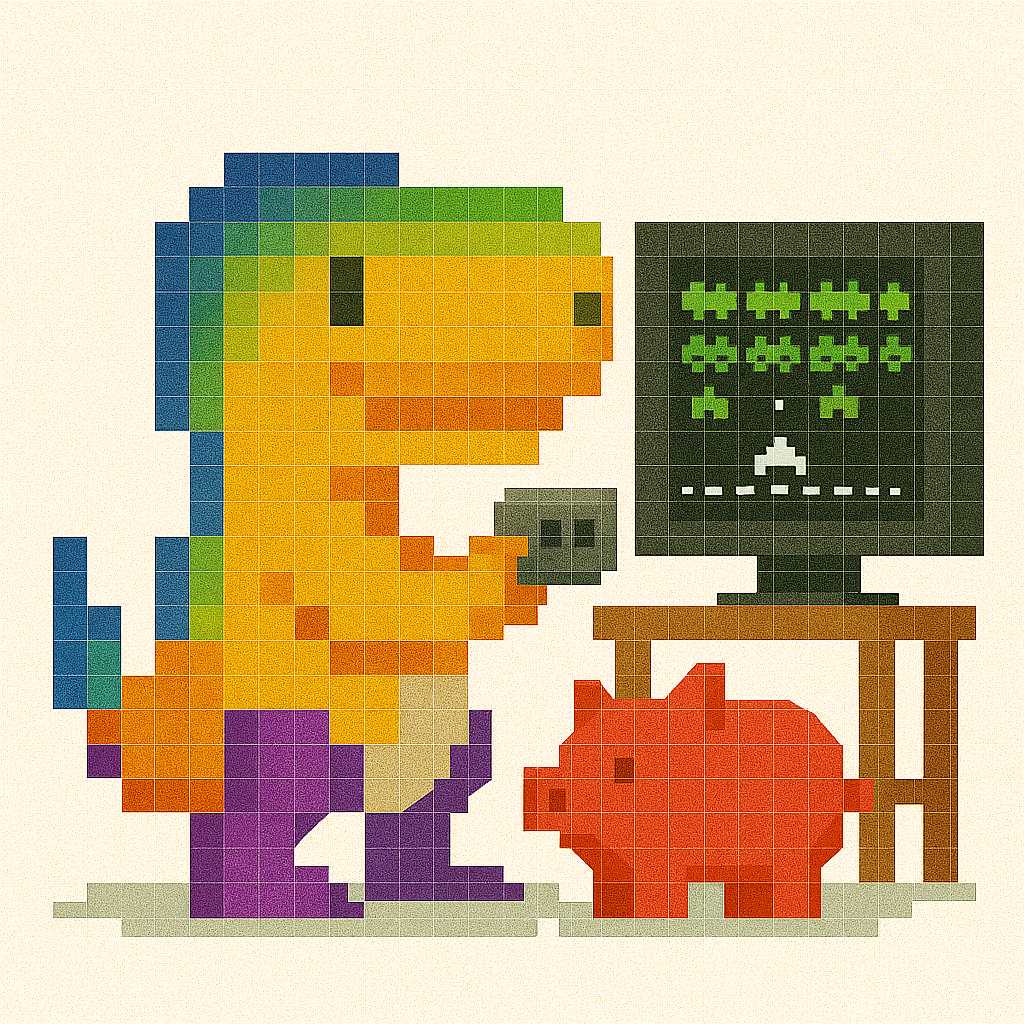
„Es passiert etwas auf dem Bildschirm, was aber nicht gleichzusetzen ist mit einem Film“, bringt Hermann das Dilemma auf den Punkt. „Und so wurden die Jugendämter aktiv, wurde die Bundesprüfstelle aktiv und hat Spiele auf den Index gesetzt.“
Diese Erfahrung prägte seine spätere Arbeit. Der VUD musste nicht nur wirtschaftliche Interessen vertreten, sondern auch grundlegende Aufklärungsarbeit leisten. Was sind Computerspiele überhaupt? Wie unterscheiden sie sich von anderen Medien? Fragen, die heute selbstverständlich erscheinen, damals aber sehr umstritten waren.
Das Gesichter-Problem einer unsichtbaren Branche
Was mich besonders fasziniert an Hermanns Rückblick: Er erkannte früh ein Problem, das die Gaming-Branche bis heute begleitet. „Wir hatten keine Gesichter“, sagt er nachdenklich. „Und in den Medien ist es ja so, ob das nun Darsteller sind oder Produzenten oder sonst was. Die werden häufig genommen, um eben Gesichter und damit auch eine Branche zu zeigen. Wir hatten ja eigentlich nur virtuelle Figuren und die konnte man so schlecht interviewen.“
Die Filmindustrie hatte ihre Stars, die Musikbranche ihre Künstler. Aber wen sollte man interviewen, wenn über Computerspiele berichtet wurde? Mario? Lara Croft? Das Dilemma war offensichtlich, die Lösung nicht.
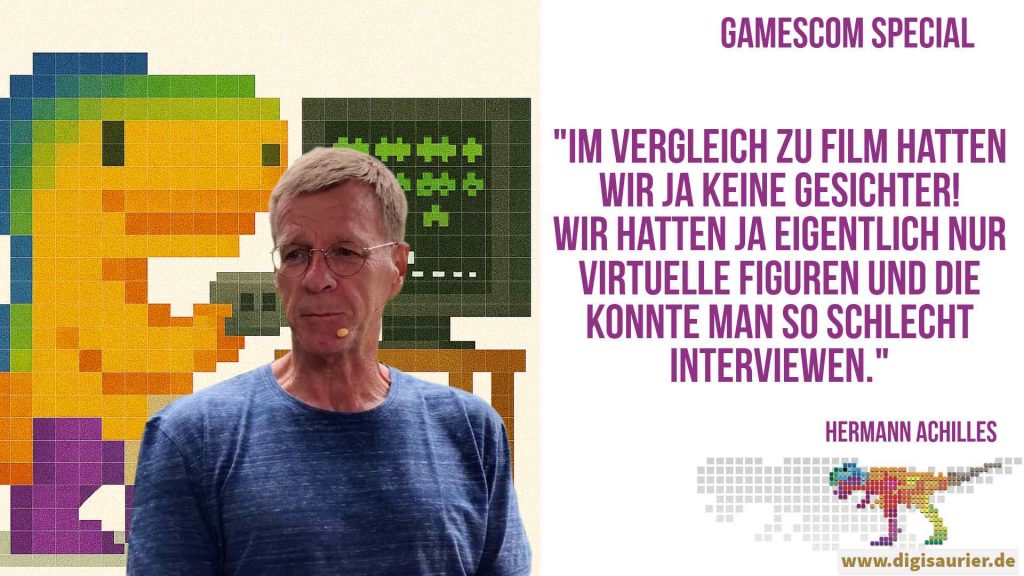
Dieses Gesichter-Problem führte zu einem Teufelskreis: Ohne prominente Persönlichkeiten bekam die Branche wenig Medienaufmerksamkeit. Ohne Medienaufmerksamkeit wurden auch die Menschen dahinter nicht bekannt. Ein Dilemma, das innovative Lösungen erforderte.
Von der Amiga-Messe zur Games Convention
Hermanns kreativste Lösung war zugleich seine erfolgreichste: die Games Convention. „Wir mussten etwas machen, damit wir mehr Medienaufmerksamkeit bekommen“, erklärt er die Grundidee. „Und das bekommen wir dann, wenn wir einen Event starten, auf dem was los ist.“
Die Inspiration kam von der erfolgreichen Amiga-Messe in Köln, die in den 80ern und 90ern bis zu 60.000 Besucher anzog. Aber der Amiga hatte, wie Hermann diplomatisch formuliert, „irgendwie ein Verfallsdatum“. PlayStation und andere Konsolen eroberten den Markt, brauchten aber eine neue Plattform.

„Also brauchen wir auch den Endverbraucher“, erkannte Hermann. „Wir müssen zeigen was sind das für Leute?“ Sind das nur so Freaks, wie damals oft in den Medien gesagt wurde? Die schließen sich irgendwo ein, spielen im dunklen Kämmerlein usw, essen allein Pizza in der Größe eines Wagenrades und trinken Cola in einer Menge die einen Tankwagen bei den Game-Partys braucht.
Das Konzept das entstand war richtungsweisen: Eine Kombination aus Businessmesse, Medienauftritt und Party. Party? „Ja! Klar. Wir reden über Spielen und Spiele sollen Spaß machen“, begründet Hermann die Party-Komponente. „Das ist ja letztendlich der Haupthintergrund.“
2002: Die Nacht vor dem ersten Messetag
Wenn Hermann von der ersten Games Convention 2002 erzählt, wird er nachdenklich. „Ganz ehrlich gesagt, ich habe selten so unter Druck gestanden wie 2002, als wir in Leipzig darauf gewartet haben, die Messetore zu öffnen.“
Das Drama: Eine Woche vor der Messe hatte Leipzig die Jahrhundert-Flut erlebt. „Die Leute waren mit anderen Dingen beschäftigt, als sich zu überlegen, auf eine Messe zu gehen.“ Die Ungewissheit war quälend – würde überhaupt jemand kommen?
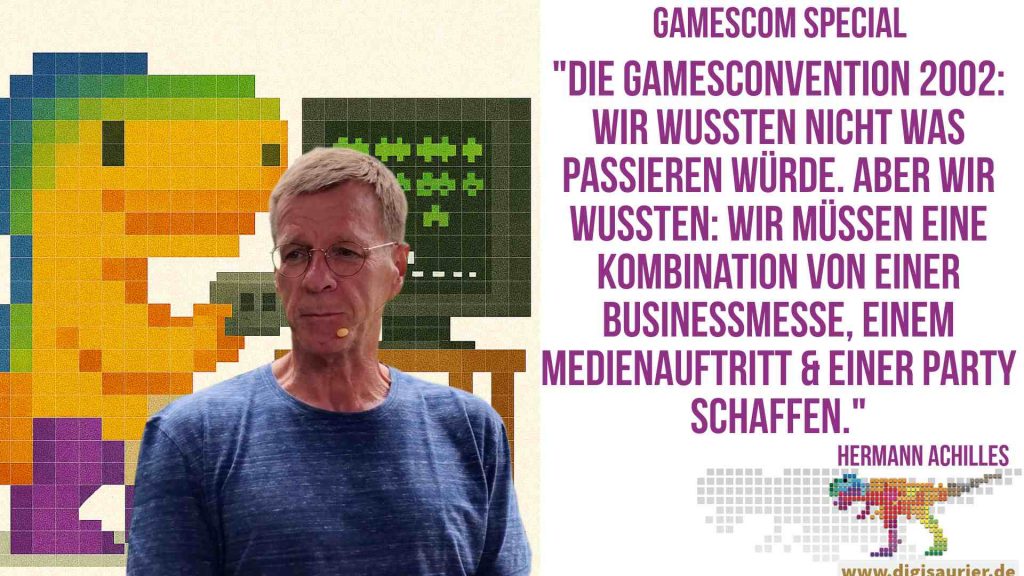
Sie kamen. Die erste Games Convention war ein voller Erfolg, alle Ziele wurden erreicht. Sogar die Bundesprüfstelle war dabei – ein symbolträchtiger Moment, der das neue Zusammenspiel zwischen Industrie und Jugendschutz demonstrierte.
Das Medienbudget-Paradox
Besonders spannend fand ich im Gespräch Hermanns Analyse des Marktwachstums. „Der Durchschnittsbürger hat ein Medienbudget und dieses Medienbudget muss er aufteilen zwischen Büchern, zwischen Film, zwischen Fernsehen, zwischen Nutzung von Handy usw und so fort“, erklärt er eine Erkenntnis, die heute aktueller ist denn je.
„Das wächst nicht damit, dass eine neue Branche dazukommt, sondern das Budget bleibt das gleiche. Es wird nur anders verteilt.“ Eine nüchterne Analyse, die zeigt: Gaming wird nicht größer, weil neue Käufer dazukommen, sondern weil es anderen Medien Marktanteile abknöpft.
Diese Einsicht erklärt auch, warum die Gaming-Branche trotz ihrer wirtschaftlichen Größe immer noch um gesellschaftliche Anerkennung kämpft. Sie konkurriert nicht nur um Geld, sondern um Aufmerksamkeit. Auch mit den Medien, die über sich berichten.
Das Vermächtnis: Ein Museum für die Ewigkeit
Was bleibt von Hermanns Arbeit? „Es gibt in Berlin das Computerspielemuseum“, sagt er nicht ohne Stolz. „Sämtliche Spielgeräte, angefangen vom C64 bis hin heute zu den Online Möglichkeiten sind da zu nutzen und zu sehen.“
Das Museum entstand aus den Überschüssen der USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, und dem Erbe des VUD. Jedes Spiel, das je eine USK-Prüfung durchlief, wurde archiviert. Ein Schatz der deutschen Gaming-Geschichte, finanziert durch die Branche selbst.
„Das lohnt sich wirklich in Berlin“, wirbt Hermann noch heute für das Museum. „Neben den bekannten Museen aus vergangenen Zeiten auch mal dieses „Zukunftsmuseum aus der Vergangenheit“ anzuschauen.“
Der Mann im Schatten der Geschichte
Was mich an Hermann Achilles fasziniert: Er war nie der Mann im Rampenlicht, aber ohne ihn sähe die deutsche Gaming-Landschaft völlig anders aus. Während wir alle Spiele spielten und kritisierten, half er ganz vorne mit die Strukturen aufzubauen, die es überhaupt ermöglichten, dass aus einer Nische eine Industrie wurde.
Was würdest Du heute, mit all dem Wissen über die Entwicklung anders machen?, frage ich ihn. „Ich würde mit Sicherheit als Geschäftsführer dieses Verbandes noch versuchen, andere Wege in der Politik zu gehen“, sagt er selbstkritisch über seine damalige Arbeit. „Da ist sicherlich eine ganze Menge noch aufzuholen in dem Bewusstsein, was Computerspiele wirklich sind.“
Auch heute, 20 Jahre nach der ersten Games Convention, ist das Gesichter-Problem nicht völlig gelöst. Zwar gibt es mittlerweile Streamer und bekannte Entwickler, aber die Branche kämpft immer noch um die Anerkennung, die Film und Musik längst haben.
Erinnerung an einen stillen Wegbegleiter
Unser Gespräch endete mit der Erinnerung an Ronald Schäfer, Hermanns langjährigen Wegbegleiter, der vor einigen Jahren verstarb. „Der Ronald ist leider verstorben“, sagt Hermann leise. Und man merkt, wie eng die Verbindung dieser beiden unterschiedlichen Weggefährten war. „Er war der Jurist des Verbandes, kam aber letztendlich auch aus der Publisher Szene. Hatte ein enormes Wissen und deshalb auch ein einzigartiges Engagement.“
Solche Menschen vergessen wir zu schnell. Während wir uns an legendäre Spiele und spektakuläre Firmen-Geschichten erinnern, verschwinden die stillen Architekten der Branche oft aus dem Gedächtnis.
Hermann Achilles war einer dieser Architekten. Ronald Schäfer ein anderer. Branchenleute, die erkannten, dass eine chaotische Szene Strukturen brauchte, um zu überleben. Die verstanden hatten, dass es nicht reicht, großartige Spiele zu machen – man muss auch die Welt davon überzeugen, dass sie wichtig sind.
Kennt ihr noch die X-Copy-Zeiten? Habt ihr die ersten Games Conventions miterlebt? Erzählt uns eure Erinnerungen an die wilden Anfänge der deutschen Gaming-Industrie!
Das vollständige Interview mit Hermann Achilles gibt es als Video auf unserem YouTube-Kanal und als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Geschichten aus der deutschen Computer-Geschichte findet ihr natürlich auch dort und hier digisaurier.de.

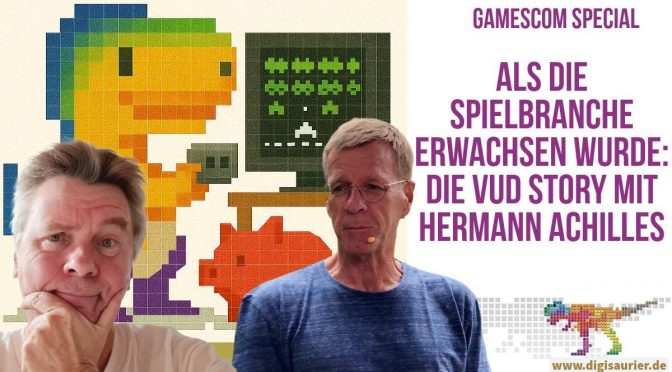
Auf der Amiga-Messe war ich damals zweimal (ich wohne im Kreis Herford):
Hingefunden habe ich (ohne Navi) immer auf Anhieb, aber beim Rückweg fand ich nicht mehr aus Köln heraus: Ich landet wieder beim Ausgangspunkt! Erst beim zweiten oder dritten Versuch hatte ich endlich den Ausweg gefunden.
Gleiches als ich Ende der 90er zu einem Konzert am Ronkalliplatz wollte: Hin, trotz erzwungen Umweg durch Baustelle sofort, der Rückweg begann aber wieder mit einer längeren Irrfahrt durch Köln.
Ich mag Köln deswegen nicht besonders… ;-)