[Titelbild: Richard Dawson via Wikimedia]
Dass der finnische Programmierer Linus Torvalds ab 1991 quasi im Alleingang den Kernel eines neuen Unix-Betriebssystems für kleine Computer schrieb, gehört zu den vielen historischen Meilensteinen, die in der Computerei an Personen gebunden sind. Wer aber den sympathischen Typen, der zur schwedischsprachigen Minderheit in Finnland zählt, als „Erfinder“ von Linux apostrophiert, irrt. Denn der Entstehung dieses Systems ging eine Bewegung voraus, die sich quer durch die globale Nerd-Szene der Achtzigerjahre zog: Die Experten hatten von den aus ihrer Sicht üblen Betriebssystemen à la MS-DOS oder Schlimmerem die Nase voll. UNIX galt ihnen als das perfekte Betriebssystem, das allerdings so ohne weiteres nicht auf kleine Computer übertragbar war. Außerdem war in jenen Jahren die Frage nach dem OS eine politische Frage. In den Universitäten weltweit herrschte die Meinung vor, Information müsse frei sein, Computer seien für jedermann, und kein Unternehmen dürfe auch nur ansatzweise ein Monopol auf irgendetwas haben – schon gar nicht Microsoft.
Denn Redmond galt den Nerds, Geeks und Freaks als der Ort des Bösen, Bill Gates gleichzeitig als Verräter und Profitgeier. Und weil „die Szene“ über Mailboxen und BBS bestens vernetzt war, entstand der Plan, ein UNIX für den persönlichen Computer zu entwickeln. Ausgangspunkt war das 1984 gestartete GNU-Projekt, das vor zwei Ziele verfolgte: erstens den Menschen vollkommen freie (Frei im Sinne von Freibier) Software zu bieten und zweitens eine Betriebssystemumgebung auf dem höchsten Stand der Technik dafür zu schaffen. Wir wissen heute, dass diese Bewegung über alles betrachtet erfolgreich war und ist. Und Linux ist nur ein Teil davon.
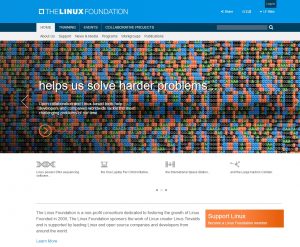
Open Source ist vollkommen akzeptiert
„Open Source“ ist inzwischen eindeutig definiert. So bezeichnet man Software jeglicher Art, deren Quellcode von den Entwicklern vollständig offengelegt wird, sodass andere Entwickler diesen nutzen, ändern und adaptieren können. Über die kommerzielle Verwertung sagt der Begriff also nichts aus. Im Gegenteil: Millionen Anwendungen im Business-Bereich basieren auf Open-Source-Projekten, werden aber nicht als „freie“ Software verschenkt. Im Gegenteil… Nachdem gerade öffentliche Institutionen über lange Zeit die Finger vollständig von auf Open-Source-Code basierten Systemen ließen, greifen inzwischen auch in der Bundesrepublik viele Bundesländer und Kommunen sowie Einrichtungen des Bundes zu solcher Software. Das ließ sich in der Open-Source-Hall der CeBIT 2016 an jeder Ecke feststellen. Wobei der Linux-Kernel dabei fast immer eine, wenn nicht die führende Rolle spielt.
Aber da wollte Torvalds ebenso wenig hin wie Stallman. Beiden ging es vor allem um den persönlichen Computer, also um den Rechner, der einer Person gehört, der von einer Person genutzt wird, über den eine Person herrscht, über die sie sich mit anderen autonomen Individuen vernetzt. Aus dieser Haltung heraus entstanden ab etwa 1995 nacheinander gut zwei Dutzend Linux-Distributionen. Damit gemeint sind vollständige Betriebssysteme für kleine Computer, die so wie sie sind installiert werden können, eine Benutzeroberfläche haben und diverse Werkzeuge gleich mitbringen. Allein die Fragen nach DER Benutzeroberfläche hat über Jahre die Linux-Community gespalten. Denn während die Puristen die Wahl zwischen verschiedenen UIs haben wollten, plädierten die Pragmatiker erstens für grafische Benutzeroberflächen (GUI) und dann auch für möglichst windows- oder mac-ähnliche. Je mehr sich die zweite Fraktion durchsetzte, desto anwenderfreundlicher wurden Linux-Distributionen und desto mehr kleine Computer (vor allem solche, die für Windows vorgesehen sind) wurden mit Linux ausgerüstet.
Linux immer noch prima für persönliche Computer
Das hat bis heute zwei wesentliche Vorteile für den Nutzer: Geschwindigkeit und Sicherheit. Selbst ein komplettes Ubuntu-Linux mit allem Zipp und Zapp läuft auf einem Laptop von 2006 mit einem GB RAM(!) problemlos und erstaunlich schnell. Und weil der Kernel schwer angreifbar ist und es so viele Distributionen gibt, hat es kaum je ernsthafte Schadsoftware-Angriffe auf Linux-Systeme für kleine Rechner gegeben. Zudem gibt es Hunderttausend kostenlose, mächtige und ausgereifte Anwendungsprogramme, die den kommerziellen Programm wie MS Office & Co. in nichts nachstehen und zudem meistens auch noch datenkompatibel sind. Weil Distributionen wie Ubuntu oder Mint inzwischen auch in Sachen Installation und Konfiguration narrensicher sind, muss kein Nutzer mehr in der Shell mit Kommandozeilenbefehlen hantieren, um diese oder jene Einstellung vorzunehmen. Andererseits haben die Nerds immer noch Zugriff auf jede einzelne Stellschraube im Linux-Kernel und können sich ihr System so exakt nach ihren Bedürfnissen einrichten.

Konkurrenz durch Microsoft nimmt zu
Dafür hat Linux aber schon vor rund 10 Jahren einen Bereich erobert, auf dem die OS-Giganten Microsoft und Apple entweder nicht angetreten waren oder Murks lieferten: bei den Betriebssystem für Webserver. Weltweit läuft auf gut 50 Prozent aller aktiven HTTP-Server das berühmte Apache, und das wird überwiegend auf Linux-Systemen betrieben. Und wer selbst einen Webserver betreiben will, greift in gut der Hälfte der Fälle zur LAMP-Umgebung. Die setzt sich zusammen aus Linux als Betriebssystem, Apache als HTTP-Server, MySQL als Datenbanksystem und PHP als Programmiersprache. Überall wo Entwickler eine Testumgebung für Web-Seiten und/oder -Applikationen brauchen, kommt LAMP zum Einsatz.
Die Dinge sind aber im Fluss. Seit Jahren holt Microsoft IIS auf und befeuert inzwischen schon rund 10 Prozent aller aktiven Websites; der Markanteil bewegt sich schnell in Richtung 30 Prozent. Im Gegensatz zu Apache ist Microsoft Internet Information Services eine Serviceplattform, über die eben nicht nur Websites ausgeliefert werden können, sondern auch web-basierte Anwendungen (ASP.NET).
Aber der Wettbewerb, in den auch Linux involviert ist, findet inzwischen mehr auf einem anderen Feld statt. Das Stichwort lautet „Internet of Things“ (IoT). IoT-fähige Geräte – von der Glühlampe bis zur Überwachungskamera – brauchen ein Betriebssystem, um sich mit dem Internet verbinden zu können, In- und Output zu verarbeiten und entsprechend Aktionen auszulösen. Ein solches System darf nur sehr wenig Speicherplatz verbrauchen und muss sehr, sehr schnell reagieren. Beides trifft aber auf die aktuelle Version des Linux-Kernels nicht zu. Deshalb hat die Linux-Foundation vor Kurzem das Projekt „Zephyr“ gestartet, das ein Echtzeit-Betriebssystem für das IoT entwickeln soll – und zwar ohne den Linux-Kernel zu nutzen.
Linux ist quicklebendig
Über alles betrachtet ist Linux keineswegs tot, sondern quicklebendig. Allerdings auf anderen Ebenen und vor allem als System zur Steuerung von Netzwerken und von Webservern. PCs, die ab Werk mit einer Linux-Distribution ausgerüstet sind, findet man kaum noch, auch auf mobilen Geräten ist Linux als Betriebssystem praktisch nicht vorhanden. Ob das so bleibt, hängt vor allem davon ab, was Microsoft als nächstes tut. Deutet man die Signale der Entwicklerkonferenz Build 2016 richtig, dann findet in Redmond derzeit ein tiefgreifender Paradigmenwandel statt, der weg führt von der alten Konstruktion von Betriebssystem und Anwendungsprogrammen hin zu kommunikationsgesteuerten Prozessen. Facebooks Mark Zuckerberg ist auf den Zug, der mit dem Zauberwort „Bots“ verbunden ist, ja schon aufgesprungen. Die Linux-Community ist dagegen von einem solchen grundsätzlichen Umdenken weit entfernt. Und das könnte à la longue zum langsamen Sterben dessen führen, was Linus Torvalds vor inzwischen 25 Jahren begonnen hat.


