Jeder elektrotechnisch gebildete Mensch zuckt schon bei der Überschrift ein bisschen zusammen. Aber wie halten es mit Lehrer Bömmel und sagen: Watt issen Akku? Da stelle mer uns janz dumm. Und beginnen einfach mit dem, was Akkus können: Sie speichern elektrischen Strom, geben ihn wieder ab und können aufgeladen werden. Damit unterscheiden sie sich schon einmal von dem, was landläufig „Batterie“ genannt wird. Die wesentliche Funktion von Akkus und Batterien ist es, Geräte mit Strom zu versorgen, die nicht an einer Steckdose angeschlossen werden können – heutzutage in erster Linie mobile Devices.
Von der Telegraphie zur Autobatterie
Die Karriere von Akkumulatoren – wie sie korrekt heißen – begann im Zusammenhang mit der elektrischen Telegrafie. Denn die wurde erfunden und im großen Stil angewendet, bevor es überhaupt Stromnetze gab. Ja, die erste rasante Entwicklung dieser Technologie verlief zwischen 1803 und etwa 1860 rasant. Den ersten Akku, der wiederaufladbar war, bastelte ein gewisser Johann Wilhelm Ritter, der im Hauptberuf Philosoph war. Mit dem Bleiakku, den der Niederrheiner Wilhelm Josef Sinsteden 1854 erdachte und baute, wurden die Dinger alltäglich nutzbar.
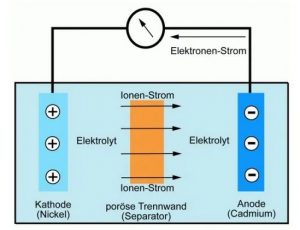
Akkus statt Batterien
Und weil kleine leistungsfähige Akkus auch um 1980 herum rar und teuer waren, entschied der geniale Sir Clive Sinclair, dass sein für die damalige Zeit ungeheuer innovative Z88 – der Vorläufer unserer Tabletcomputer – mit ganz normalen Batterien ausgerüstet wurde. Da waren die Hersteller von Portables und Laptops bereits auf einem anderen Trip – zum Beispiel Epson mit dem HX-20, der vom Taschenrechner abstammte, ein vollwertiger Computer war und abseits der Steckdose mit einem Akku betrieben wurde, der unter optimalen Bedingungen (ohne Nutzung des eigebauten Druckers zum Beispiel) Saft für bis zu sechs Stunden Betrieb lieferte.

Alles auf Lithium!
Schon 1970 wurde an der TU München der Lithium-Ionen-Akku entwickelt, aber es dauerte bis 1991 bis ein großer Hersteller (Sony) einen Li-Ion-Akku serienmäßig in einem Gerät (Camcorder) einsetzte. Diese Dinger können deutlich mehr Strom speichern und mit höherer Spannung abgeben, reagieren aber auf Totalendladung und Überladung empfindlich bis hin zum Exitus. Deshalb müssen sie mit Schutzschaltungen ausgerüstet sein. Weil die Technik dafür aber vergleichsweise trivial ist, haben sich Akkus auf Lithium-Basis – Stand heute – als Treibstoff für mobile Geräte aller Art durchgesetzt.

Und in der Zukunft?
Der Rohstoff Lithium, der in Form von Lithium-Carbonat in die industriellen Prozesse gelangt, wird vorwiegend aus Salzwasser gewonnen – wobei erhebliche Mengen an Energie gebraucht werden. Weil das Salzwasser an vielen Lagerstellen (ebenfalls mit viel Energieeinsatz) aus der Tiefe gepumpt wird, bleibt es an der Oberfläche zurück, wodurch sowohl Flächen, als auch Grundwasser versalzt werden können. Beim Bedarf für die kleinen Akkus für mobile Geräte spielten die negativen Umweltauswirkungen nur eine geringe Rolle – die Verbreitung von e-Autos spitzt das Problem zu. Gleichzeitig hat vor wenigen Jahren das großtechnische Recycling von Lithium aus Akkus begonnen.



