Und es blieb kompliziert. Über die Gründe, warum Nolan Bushnell Atari 1976 an Warner Communications verkaufte, gibt es verschiedene Geschichten. Die Situation war jedenfalls so, dass das Geschäft mit den Arcade-Maschinen nicht mehr so gut lief wie in den ersten Jahren und dass Atari mit den Spielkonsolen für den Hausgebrauch nicht sehr viel Geld verdiente. Man hätte den Verkaufspreis deutlich erhöhen müssen, um bei der doch recht aufwändigen Fertigung ausreichende Profite erzielen zu können. Witzigerweise wirkten die späteren Apple-Gründer Steve Jobs und Steven Wozniak 1975 kurze Zeit für Atari, und letzterer entwickelte preisgünstigere Herstellungsverfahren, die aber nur teilweise umgesetzt wurden.
Die eine Version besagt, dass Nolan Bushnell unbedingt in den gerade beginnenden Homecomputer-Markt einsteigen wollte, aber Unmengen an Geld in die Entwicklung der später legendären Videospielkonsole VCS 2600 gesteckt hatte. Dafür und für die parallele entstehende Menge an Konzepten – die Atari-Ingenieure entwickelten Dutzende davon – reichte die Eigenkapitaldecke nicht. Gleichzeitig begann die Unterhaltungsindustrie sich für den Markt der Videospiele zu interessieren. Da kam Warner Communications die Notlage Ataris gerade recht. Für den Entertainment-Giganten waren die zu zahlenden 28 Millionen US-Dollar ein Schnäppchen.

Eine andere Variante der Story: Nolan Bushnell hatte die Nase vom Computerspiel voll und wollte etwas ganz anderes machen. Wir wissen ja, dass der gute Nolan immer den Kopf voller Ideen hatte, die sich nicht immer auf die Elektronik bezogen. So gründete er 1977 beispielsweise die Fastfood-Kette Chuck E. Cheese Pizza. Pläne hatte er auch rund um das Thema Heimroboter. Mit seinem Anteil an den 28 Millionen erwarb er 1977 einen riesigen Herrensitz, auf dem er dann mit seiner Frau Nancy und den gemeinsamen acht Kindern lebte. Es kann also auch so sein, dass Bushnell einfach erkannt hatte, dass er nicht den Rest seines Lebens mit einer Firma und einem Thema verbringen wollte.
Er blieb dann noch zwei Jahre lang Berater, während Warner mit Ray Kassar einen fachfremden Manager, einen ausgewiesenen Marketingexperten, als Atari-Boss einsetzte. In den letzten Jahren der Siebzigerjahre hatte das Unternehmen eine große Anzahl begnadeter Hardwareingenieure und Softwareentwickler für sich gewinnen können – aber niemanden, der diese überbordende Kreativität wirklich zu managen wusste. Immerhin gelang es, mit diesem gewaltigen Know-how, dem durch den Verkauf an Warner zur Verfügung stehenden Budget und einem fundierten Marketingplan 1977 mit der VCS 2600 die erste mikroprozessorbasierte Spielekonsole auf den Markt zu bringen.

Das Hirn der Konsole war ein MOS 6507, eine speziell für diese Maschine entwickelte Version des MOS 6502. Die Grundidee war es, einen auf Spiele spezialisierten Computer zu bauen, der mit einem Betriebssystem samt zugehöriger Programmierumgebung jede Menge verschiedener Games spielbar zu machen. Bei den bisherigen Konsolen war in der Regel maximal eine Handvoll Spiele fest in der Hardware verankert. Das Problem war der mögliche Verkaufspreis, der – das hatten Großabnehmer wie Wall Mart vorgegeben – 200 US-Dollar nicht überschreiten sollte. Das wäre aber nur möglich, wenn man die CPU für maximal 30 Dollar würde herstellen können. Als diese Fragen alle zufriedenstellend gelöst waren, konnte Atari mit der VCS 2600 rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 1977 in den USA an den Start gehen.
Das Gerät wurde aus dem Stand zum Verkaufsschlager. Aber in den Atari-Laboren rumorte es. Könner wie Larry Kaplan, Bob Whitehead und David Crane – die späteren Gründer von Activision – bildeten die Fraktion der Spielentwickler, Jay Miner und Kollegen, die im Atari-Auftrag am Thema Homecomputer arbeiteten, die andere. Mehrfach beschwerten sich, dass ihre Namen nicht in den von ihnen entwickelten Games genannt wurden. Also verließen sie den Laden. Gleichzeitig aber kamen 1979 mit dem Atari 400 und dem Modell 800 die ersten beiden Homecomputer der Firma auf den Markt. Auch die basierten auf MOS-Prozessoren, enthielten aber für damalige Zeiten äußerst fortschrittliche Schaltkreise für die Tonerzeugung und die Bildschirmansteuerung – beides Themen, die von Jay Miner und seinem Team bei seiner Firma Amiga als Auftragsarbeit für Atari vorangetrieben wurden.
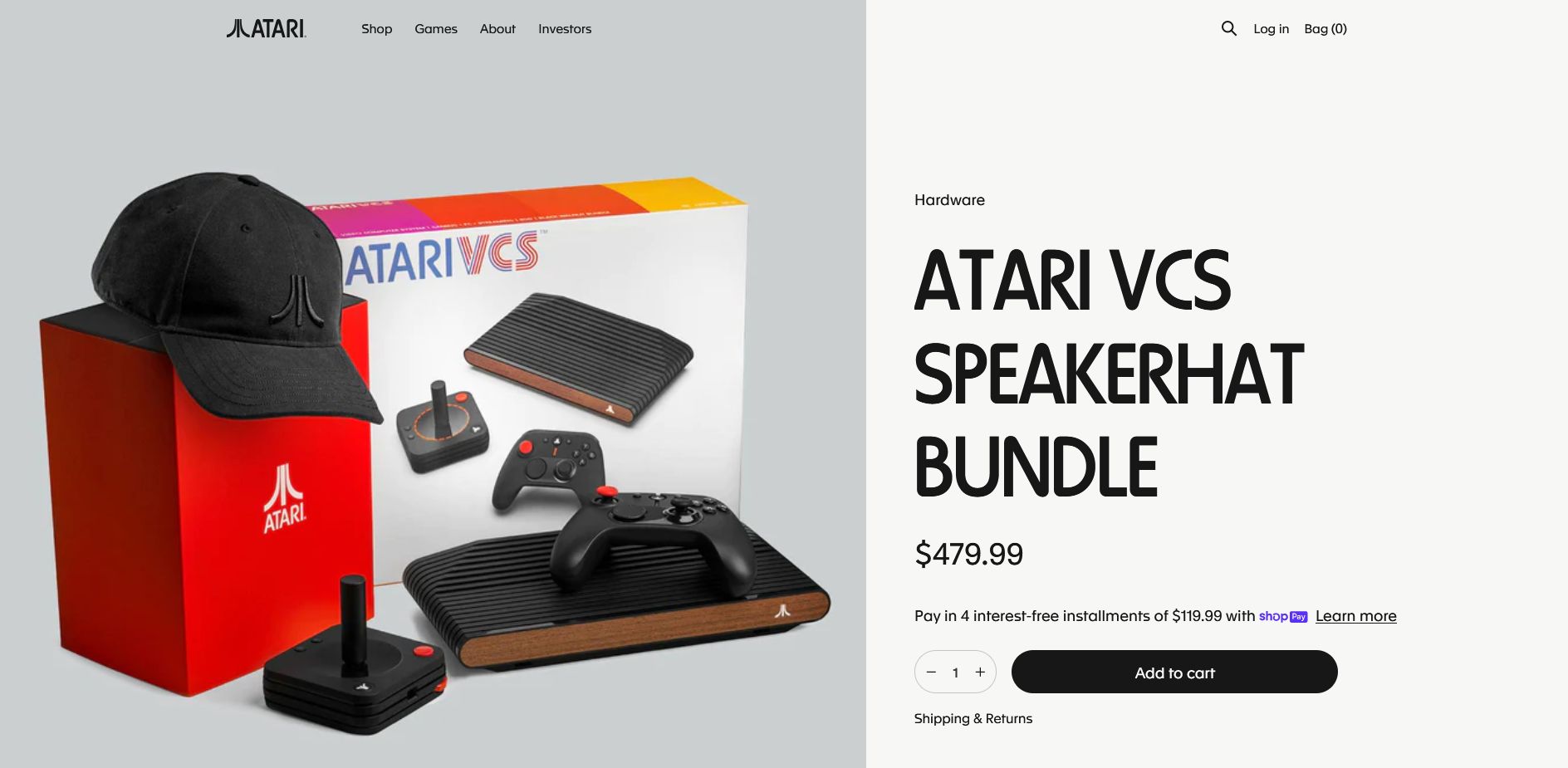
Und damit sind wir beim Projekt Lorraine, einem legendären, leicht geheimniswitterten Projekt, das beinahe in den Wirren des jungen Homecomputermarktes untergegangen wäre. Der war bei allen relevanten Protagonisten – von Apple über Commodore bis zu Tandy und anderen – geprägt durch die einander oft widersprechende Auffassungen von Ingenieuren, Kapitalgebern und Managern. Während Apple über lange Zeit allein deswegen erfolgreich waren, weil das Team Jobs-Wozniak diese Widersprüche elegant umschiffen konnte, lag das Erfolgsgeheimnis von Commodore in der Person von Jack Tramiel. Bei Atari aber herrschte nach dem endgültigen Abschied von Nolan Bushnell 1978 und dem Rausschmiss von Kassar 1982 unter der Herrschaft von Warner mehr oder weniger Chaos.
Der Vertrag zwischen Atari und Amiga sah vor, dass Jay Miners Laden bis 1984 einen verbesserten Chipsatz für Sound und Grafik unter dem Codenamen „Lorraine“ liefern sollte, mit dem Atari die nächste Generation ihrer Homecomputer bestücken wollte. Die sollte mit Motorolas 68000er-CPU laufen und damit den Schritt in die 16-Bit-Welt gehen. Aber schon ab 1980 lief es weder mit den Atari-Spielkonsolen, noch mit deren 8-Bit-Homecomputern wirklich gut. Die Verkaufszahlen waren unbefriedigend, die Kosten – besonders für einen ziemlich aufgeblähten Marketingstab – zu hoch. 1983 erwirtschaftete Atari einen operativen Verlust von mehr als 500 Millionen US-Dollar, und Warner bemühte sich darum, Atari abzustoßen.

In diesem für die Geschichte der Homecomputer entscheidenden Jahr aber überschlugen sich die Ereignisse. Atari war auf entscheidende Weise abhängig von einem gewissen Jack Tramiel, dem Gründer und Inhaber der Firma Commodore. Der hatte nämlich 1976 MOS-Technology gekauft, den Mikroprozessorpionier, der – wie wir gesehen haben – auch CPU-Lieferant für Atari war. Zwar wurden nie kurzfristige Lieferverträge geschlossen, aber Tramiel konnte Atari durch die Preisgestaltung ziemlich weh tun. Auch im Apple I und II wurde der MOS 6502 eingesetzt, in den Commodore-Kisten ab dem PET sowieso. Commodore hatte also ein Instrument in der Hand, mit dem das Unternehmen das Marktgeschehen beeinflussen konnte. Zumal man für die CPUs, die im VC20 und C64 zum Einsatz kamen, eben auch deutlich weniger bezahlen musste als die anderen.
Es hätte auf eine überragende Marktposition für Commodore bei den Homecomputern hinauslaufen können, hätte sich Tramiel 1984 nicht mit seinem alten Weggefährten Irving Gould überworfen. Der schmiss den guten Jack kurzerhand aus seiner eigenen Firma. Und zwar ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, in dem Warner Atari loswerden wollte. So wurde Jack Tramiel im Juli 1984 Haupteigner der Atari, Inc. Seine erste Tat war der Versuch, auch die kleine Firma Amiga zu kaufen. Die hatte Jay Miner nach seinem Weggang von Atari gegründet, aber den schon geschilderten Kooperationsvertrag mit seinem ehemaligen Arbeitgeber geschlossen. Dass Amiga eben nicht nur einen Chipsatz für Atari entwickelte, sondern an einer völlig neuen 16-Bit-Computerplattform mit herausragenden Sound- und Grafikfähigkeiten arbeitete, wussten nicht viele – Jack Tramiel wusste davon.
Sein Ziel war es vor allem, Commodore im Bereich der 16-Bit-Technologie zuvorzukommen. Eine Übernahme von Amiga wäre ein gangbarer Weg gegangen und hätte gleichzeitig zu einer Zusammenführung des Projekts „Lorraine“ mit dem Computerprojekt von Jay Miner geführt. Tramiel bot den (wenigen) Amiga-Aktionären knapp einen Dollar pro Aktie. Irving Gould aber schrieb kurz bevor es zum Deal zwischen Atari und Amiga gekommen wäre, einen Preis von mehr als vier Dollar aus. So kam der Amiga in den Schoss der Commodore-Familie.

Wie er nun einmal gestrickt war, wollte Jack Tramiel seinem „Erzfeind“ das Feld nicht kampflos überlassen. Er holte einen anderen alten Weggefährten, den Entwickler Shiraz Shivji, zu Atari, der den größten Teil seines alten Commodore-Teams mitbrachte. Und auch die hatten sich schon über ein 16-Bit-System Gedanken gemacht und sich vor allem mit den Motorola-68000er-Prozessoren vertraut gemacht. Während es bei Amiga schon einen fast fertigen Chipsatz für Sound und Grafik und ein Design für Motherboard und Peripherie sowie ein funktionierendes Betriebssystem gab, waren die frischgebackenen Atari-Designer noch im Konzeptstadium.
Dass Shivji und Kollegen es trotzdem schafften, noch vor den Kontrahenten bei Commodore einen marktreifen Computer zu präsentieren, gehört zu den Husarenstücken der Homecomputer-Historie. Der 520 ST wurde im Juni vorgestellt, der Amiga im Juli 1985. Die ST-Designer hatten einfach ein paar schlaue Entscheidungen getroffen. Unter anderem die, ihr TOS genanntes Betriebssystem vollständig rund um die grafische Benutzeroberfläche GEM zu bauen. GEM ein war von Digital Research als Konkurrenz Microsoft Windows positioniertes System, dass es für die Intel-Welt schon seit 1981 gab, das also praxiserprobt war und „nur“ in die 68000er-Welt portiert werden musste. Das AmigaOS war dagegen vollkommen auf die Amiga-Hardware zugeschnitten und musste vor der Freigabe ausgiebig getestet werden.

Das ST-Projekt hatte zudem den Vorteil, dass die Entwicklung der Sound- und Grafikchips nicht bei null begonnen werden musste, sondern man bei Atari auf die Vorarbeiten im Projekt „Lorraine“ aufsetzen konnte. Zudem erwies sich die Projektsteuerung unter der harten Hand von Jack Tramiel als äußerst effizient. Mit Aufgaben dieser Art hatte er ja bei Commodore ausreichend Erfahrungen gemacht. Nicht zuletzt seine vielen, über die Jahre bewährten Connections zu den verschiedenen Vertriebskanälen macht den Atari ST zum Verkaufserfolg, der immerhin sieben Jahre lang anhielt. Und dann änderte eine unternehmerische Fehlentscheidung wieder einmal alles im Haus Atari…
Und hier geht es zu Part I unserer kleinen Atari-Historie.
Im dritten und letzten Teil befassen wir uns mit dem Niedergang der Firma Atari und der komplizierten Geschichte des Markennamens.



Nette kleine Zeitreise;)
Grüße
Jochen